Abwesend sitzt sie an ihrem übervollen Schreibtisch.
Sie wirkt planlos, fahrig, überfordert und schreckt jedes Mal zusammen, wenn das Telefon klingelt.
Die sonst freundliche, temperamentvolle und schlagfertigen Frau steht völlig neben sich.
Was ist passiert?
Sie möchte nicht darüber reden. Reagiert mit Flucht oder wird aggressiv.
Erst sehr viel später vertraut sie sich mir an.
Verborgene Trauer…
Die Geschichte dahinter
Viele Jahre lang hatte sie eine Beziehung mit einem verheirateten Mann. Sie hat sich damit arrangiert, ihr Leben um seinen Terminkalender herumgebastelt. Für sie war er ihre große Liebe.
Dann starb er bei einem Autounfall. Ihr Welt blieb schlagartig stehen. Es gab niemanden, mit dem sie darüber sprechen könnte. Fehltage auf der Arbeit konnte sie sich nicht leisten.
Ein Abschied auf seiner Beerdigung blieb ihr verschlossen.
Aus Sicht der Gesellschaft hatte sie kein Recht auf ihre Trauer. Sie war nur seine Geliebte.

Wenn Trauer gesellschaftlich nicht anerkannt ist
Fakt ist: Auch als Geliebte oder nach einem gewollten Schwangerschaftsabbruch trauern die Betroffenen. Oder wenn ein hochbetagter Elternteil stirbt und trotzdem für die Angehörigen eine Welt zusammenbricht.
Es ist ein harter Prozess, wenn andere das Recht auf Trauer absprechen oder Trauer sogar sozial sanktioniert wird.
Menschen ohne „Recht“ zu trauern, tun dies im Verborgenen. Sie erleben sich in ihrem Leid allein gelassen und nicht gesehen.
Die offizielle Definition von aberkannter Trauer
„Obwohl eine Person Trauerreaktionen durchlebt, hat sie aus Sicht des sozialen Umfeldes kein Recht zu trauern und keinen Anspruch auf Mitgefühl oder soziale Unterstützung.“ (Kenneth Doka 2008)
Was sind die Gründe dafür?
- Die Beziehung ist sozial nicht anerkannt (z. B. getrennte Partner oder heimliche Liebesbeziehungen)
- Der Verlust gilt nicht als schwerwiegend (z. B. Schwangerschaftsabbrüche, Fehlgeburten oder Tod eines Haustieres)
- Der Person wird die Fähigkeit zu trauern abgesprochen (z. B. kleine Kinder oder Menschen mit geistiger Behinderung)
- Todesart/ Todesumstände wirken stigmatisierend (z. B. Suizid oder Tod eines Gewaltverbrechers)
- Die individuelle Form, Trauer zu zeigen, wird sozial abgelehnt (z. B. zu kurze oder zu lange Trauer, Gefühlsausbrüche statt Haltung oder zurückhaltende Gefühle, wo Emotionen erwartet werden)
Es sind gesellschaftlich unausgesprochene „Regeln“.
Allgemein anerkannte Vorstellungen davon, welche Reaktionen, Gefühle, Gedanken, Verhaltensweisen angemessen sind und erwartet werden.

Trauerheilung
Nach dem Gespräch mit der „Geliebten“ habe ich mich intensiv mit dem Thema Sterben und Tod auseinandergesetzt. Dabei bin ich auf die Forschungen und die Bücher von Dr. Elisabeth Kübler-Ross gestoßen.
Sie war eine schweizerisch-US-amerikanische Psychiaterin und gilt als Gründerin der modernen Sterbeforschung.
Elisabeth Kübler-Ross befasste sich mit dem Tod, dem Umgang mit Sterbenden, mit Trauer und Trauerarbeit sowie mit Nahtoderfahrungen.
Sie war eine faszinierende Frau. Ihre Bücher haben mir sehr geholfen und meine Wahrnehmung nachhaltig verändert.
Der Tod ist Teil des Lebens. Wenn ein Mensch geht, ist er nicht verschwunden. Er ist woanders – wo seine vorausgegangenen Lieben schon sind.
„Über den Tod und das Leben danach“ – meine Buchempfehlung aus tiefstem Herzen.
Fühlst du dich allein mit deiner (verborgenen) Trauer?
Lass uns gemeinsam Wege aus dem Schatten finden:
https://www.a-lamprecht-loewe.de/kontakt
Ein lieber Mensch in deinem Umfeld trauert und du bist unsicher, wie du damit umgehst?
In folgendem Blogbeitrag gehe ich darauf ein:

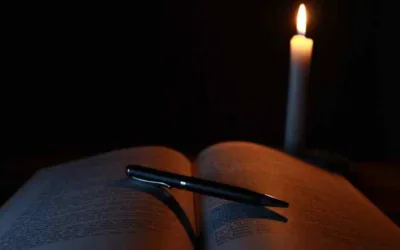

0 Kommentare